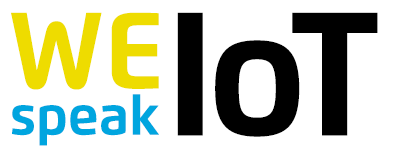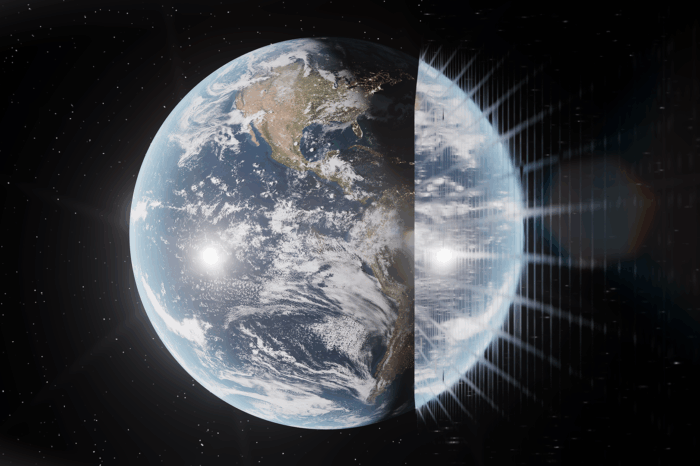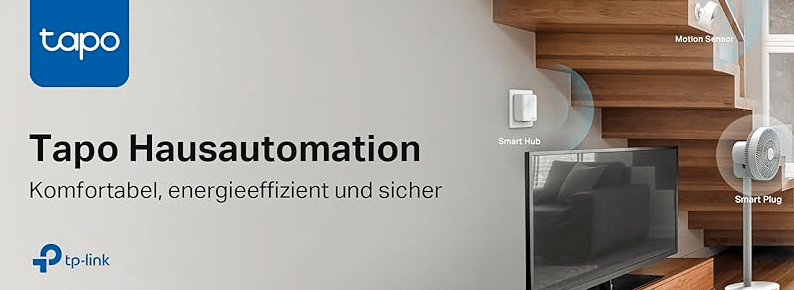Direkt, global, grenzenlos: Wie IoT Satellitennetze auch abgelegene Gebiete erreichen

Sensoren, die mitten im Ozean funken, Maschinen in der Wüste, die Daten senden – ganz ohne Mobilfunkmast. Möglich macht das die nächste Generation von IoT-Netzen: IoT Satellitenkommunikation mit dem erweiterten 5G Standard NR NTN. Wie sie funktioniert, welche Anbieter es gibt und warum sie die Welt verändern könnte, erklärt dieser Beitrag.
Inhalt
Was ist ein IoT Satellitennetz?
In klassischen IoT-Netzen senden Sensoren oder Tracker ihre Daten über ein Gateway oder direkt ins Mobilfunknetz. Doch weitab von Städten und Straßen endet diese Reichweite schnell. IoT Satellitennetze lösen das Problem: Geräte kommunizieren direkt mit Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen (LEO). Diese leiten die Daten entweder an Bodenstationen oder an andere Satelliten und IoT-Geräte weiter.
Technologisch steckt dahinter ein Trend: neue Mobilfunkstandards wie NB-IoT NTN oder 5G NR NTN. Diese sind speziell darauf ausgelegt, auch mit Satelliten zuverlässig zu funktionieren – trotz hoher Geschwindigkeiten und größerer Signallaufzeiten im Orbit.
3GPP Release 17/18 NR NTN: der Standard für IoT im Orbit
Die Abkürzung NR NTN steht für „New Radio Non-Terrestrial Networks“ und beschreibt einen Mobilfunkstandard, der erstmals offiziell die Kommunikation zwischen IoT-Geräten und Satelliten regelt. Mit dem 3GPP Release 17, verabschiedet 2022, wurde der Grundstein gelegt: Geräte können damit über LEO-, MEO- oder GEO-Satelliten Nachrichten senden und empfangen, selbst wenn kein Mobilfunknetz in der Nähe ist.
Der Nachfolger Release 18 erweitert diese Möglichkeiten um höhere Datenraten, geringere Latenzen und noch bessere Energieeffizienz. Für die Hersteller heißt das: Chipsätze und Module, die diesen Standard unterstützen, können sowohl terrestrisch im 5G-Netz als auch über Satelliten funken – nahtlos und weltweit. Für Nutzer bedeutet es mehr Verlässlichkeit: IoT-Sensoren, Tracker oder Maschinen bleiben auch dann verbunden, wenn das nächste Handymast hunderte Kilometer entfernt ist oder ganz ausfällt.
LEO, MEO, GEO – was ist der Unterschied?
- LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) kreisen in nur etwa 500 bis 2.000 Kilometern Höhe um die Erde. Weil sie näher dran sind, bieten sie kürzere Signalwege, niedrigere Latenzen und sind ideal für IoT-Kommunikation oder Echtzeitanwendungen. Allerdings deckt jeder LEO-Satellit nur einen kleinen Bereich ab, weshalb ganze Konstellationen mit Dutzenden oder Hunderten Satelliten nötig sind.
- MEO-Satelliten (Medium Earth Orbit) kreisen in mittlerer Höhe von etwa 5.000 bis 20.000 Kilometern über der Erde und bieten damit eine größere Abdeckung als LEO-Satelliten bei geringerer Latenz als GEO-Satelliten – typisch eingesetzt zum Beispiel für Navigationssysteme wie GPS oder Galileo.
- GEO-Satelliten (Geostationary Orbit) dagegen stehen in rund 36.000 Kilometern Höhe „stationär“ über einem Punkt auf dem Äquator. Sie decken riesige Gebiete ab und eignen sich besonders für Broadcast, TV und großflächige Kommunikation – haben dafür aber höhere Latenzen und brauchen leistungsstärkere Antennen bei den Endgeräten.
Einsatzgebiete: Wo macht Satelliten-IoT Sinn?
- Landwirtschaft: Bodensensoren, Pumpen oder Zäune melden ihren Status selbst auf entlegenen Feldern.
- Schifffahrt und Logistik: Container und Frachter bleiben weltweit trackbar.
- Katastrophenschutz: Frühwarnsysteme für Waldbrände oder Erdrutsche arbeiten auch bei Netzausfällen.
- Energie und Bergbau: Anlagenüberwachung an abgelegenen Standorten.
Gerade in Regionen ohne Mobilfunk oder nach Naturkatastrophen sind solche Netze unschlagbar.
Vorteile und Nachteile auf einen Blick
Vorteile
- Globale Abdeckung – unabhängig vom Mobilfunknetz
- Robust auch bei Strom- oder Netzausfällen
- Weltweit einheitliche Standards
Nachteile
- Höhere Kosten für Endgeräte durch spezielle Chips & Antennen
- Größerer Energieverbrauch – wichtig bei batteriebetriebenen Sensoren
- Geringe Bandbreite – nur für kleine Datenpakete geeignet
Welche Technik brauchen die Geräte?
Geräte müssen spezielle Chipsätze für NB-IoT NTN oder 5G NR NTN verbaut haben, passende Antennen und Software für Satellitenrouting. Hersteller wie Qualcomm und Sony entwickeln Module, die Mobilfunk und Satellitenkommunikation kombinieren. Das Ziel: IoT-Geräte, die nahtlos je nach Empfangslage zwischen terrestrischen Netzen und Satelliten wechseln können.
Die wichtigsten Anbieter und ihre Netzwerke
- Iridium: 66 aktive LEO-Satelliten. Einsatz in Logistik, Schifffahrt, Militär und bald NB-IoT via Stardust-Projekt.
- Lacuna Space: kleine LEO-Konstellation, offen für NB-IoT Standard. Fokus auf günstige Sensoren für Landwirtschaft und Umwelt.
- AST SpaceMobile: wenige große Satelliten mit riesigen Antennenflächen. Ziel: Direktverbindung zu Standard-Smartphones & IoT.
- Lynk Global: Hunderte Satelliten geplant, Schwerpunkt auf SMS, Notrufkommunikation und IoT in Entwicklungsländern.
- Viasat & Skylo: nutzen GEO-Satelliten, Zielgruppe Landwirtschaft, Industrie und maritime Anwendungen.
Fazit: Chancen und Grenzen
IoT Satellitennetze sind ein echter Gamechanger für Sensorik und Tracking überall dort, wo Mobilfunk nicht hinkommt: Schiffe, Wüsten, Gebirge oder Katastrophengebiete. Sie können Versorgungslücken schließen und kritische Infrastruktur absichern.
Doch sie sind kein Ersatz für Mobilfunk oder Glasfaser, wenn große Datenmengen übertragen werden müssen. Und Endgeräte sind aktuell noch teurer und energiehungriger. Der Erfolg hängt davon ab, wie schnell Kosten sinken und die Technik kleiner und sparsamer wird.
Fest steht: Für globale Logistik, Landwirtschaft, Energie oder Katastrophenschutz könnten IoT Satellitennetze schon bald so selbstverständlich sein wie heute WLAN und Mobilfunk.